top of page


Ausgabe 04/2022 - Neue Forschungsergebnisse
Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen (DINA)
Verbundforschungsvorhaben zum Insektenschwund
Diese Website zieht um!
Ab sofort finden Sie Informationen rund um DINA hier.
Bis August wird auch diese Seite noch für Sie zur Verfügung stehen und aktuelle Erkenntnisse aus dem Projekt bereitstellen.
Deutschland hat sich zum Schutz der Biodiversität verpflichtet. Um den Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten und in einen positiven Trend umzukehren, brauchen wir Datengrundlagen – vor allem in Naturschutzgebieten. Im Rahmen des Forschungsprojektes DINA (Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen) soll die Insektenvielfalt in Naturschutzgebieten erfasst und dokumentiert werden. Dazu werden bundesweit in 21 repräsentativen Gebieten mit standardisierten Monitoring-Methoden Insektenpopulationen erfasst sowie die Umwelteinflüsse auf die Tiere erforscht.
Zudem soll die Zivilgesellschaft von Anfang an aktiv mit eingebunden werden. Wissenschaftliche Daten werden innerhalb des Projektes transparent geteilt und es sind öffentliche Veranstaltungen rund um das Thema Insekten geplant. An diesem Diskurs können sich Vertreter von Landesbehörden, Landes- und Bundesministerien, Landwirte und deren Verbände sowie Interessierte aus Gesellschaft und Wirtschaft beteiligen.

Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius) aus der Familie der Buntkäfer (Cleridae), auch "Bienenwolf" genannt, parasitiert Nester von Wildbienen und Grabwespen.
Verfahrensweise von DINA
Die Naturschutzgebiete wurden basierend von Lage und Registerdaten ausgewählt. Eine weitere Grundvoraussetzung für die Freilandarbeit ist natürlich auch die Kooperation von Naturschutzbehörden und Landbesitzern oder Pächtern benachbarter Felder. Die Methode orientiert sich an etablierten Standards. Die Diversität von Fluginsekten wird entlang von Beobachtungspunkten in regelmäßigen Abständen durch standardisierte Fangmethoden erfasst. Die Zusammensetzung der Insektengemeinschaften werden durch Metabarcoding untersucht - denn jede Insektenart hat einen einzigartigen genetischen Fingerabdruck. Mit diesem DNA-Barcoding können die Arten automatisiert erfasst werden. Unser Insekten-Monitoring wird die bisher umfangreichsten Daten für von fliegenden Insektenarten in Schutzgebieten in Deutschland generieren. Die Vegetation wird einerseits durch klassische Aufnahmen, andererseits durch Metabarcoding von Pollen und Pflanzenresten aus den Malaise-Fallen untersucht.
Chemische Analysen liefern Informationen über den aktuellen Stand der Pestizidbelastung in Boden, Vegetation und Bäumen an den Standorten sowie in angrenzenden, landwirtschaftlichen Flächen. Der Nachweis kann einen Zusammenhang zwischen der Belastung durch Pestizide und der Biodiversität von Insekten zeigen.
Die Erkenntnisse aus dem Monitoring und den Schadstoffanalysen in DINA sollen in konkrete Empfehlungen zum Schutz der Artenvielfalt für Politik, Landwirtschaft und Kommunen münden. Die hierfür konzipierten Dialogformate tragen zum besseren Verständnis von Konflikten bei und zielen auf eine gemeinsame, robuste Lösungsfindung. Deshalb werden an drei der 21 Standorte eine Reihe von Dialogworkshops mit Akteuren aus Praxis und Wissenschaft stattfinden. Der kontinuierliche Austausch dient sowohl der Vernetzung zwischen den Akteuren als auch der Konsensfindung für Ziele und Maßnahmen für einen integrierten Naturschutz.

Übersichtskarte über die 21 Naturschutzgebiete, welche im Projekt betreut werden.
Video von Dennis Brüggen und Philipp Leonhard Reddig über das DINA Projekt.

Mitarbeitende vor Ort
Um den Citizen Scientist Ansatz innerhalb von DINA zu vertiefen, wird das Projekt an den Standorten von ehrenamtlichen Naturschützer*innen betreut. Neben der Mitarbeit bei der Erfassung der Insekten werden sie zudem Proben für die Belastungsanalysen aus Bodenentnahmen nehmen. Gleichzeitig sollen sie aber auch in Fragen zum Insektenschwund und deren Schutz sowie im Stakeholder-Management weitergebildet werden. Eine verbesserte Ansprache der Betroffenen durch die Ehrenamtlichen soll als Ergebnis des Stakeholder-Ansatzes einen zusätzlichen Beitrag zum besseren Schutz der Insekten in Schutzgebieten leisten.
NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.)
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)
Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK)
Entomologischer Verein Krefeld (EVK)
Universität Kassel (UniKS)
Universität Koblenz-Landau (UKL)
Integrierte Umweltüberwachung (TIEM, im Auftrag des NABU)
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (IZNE)
Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE)



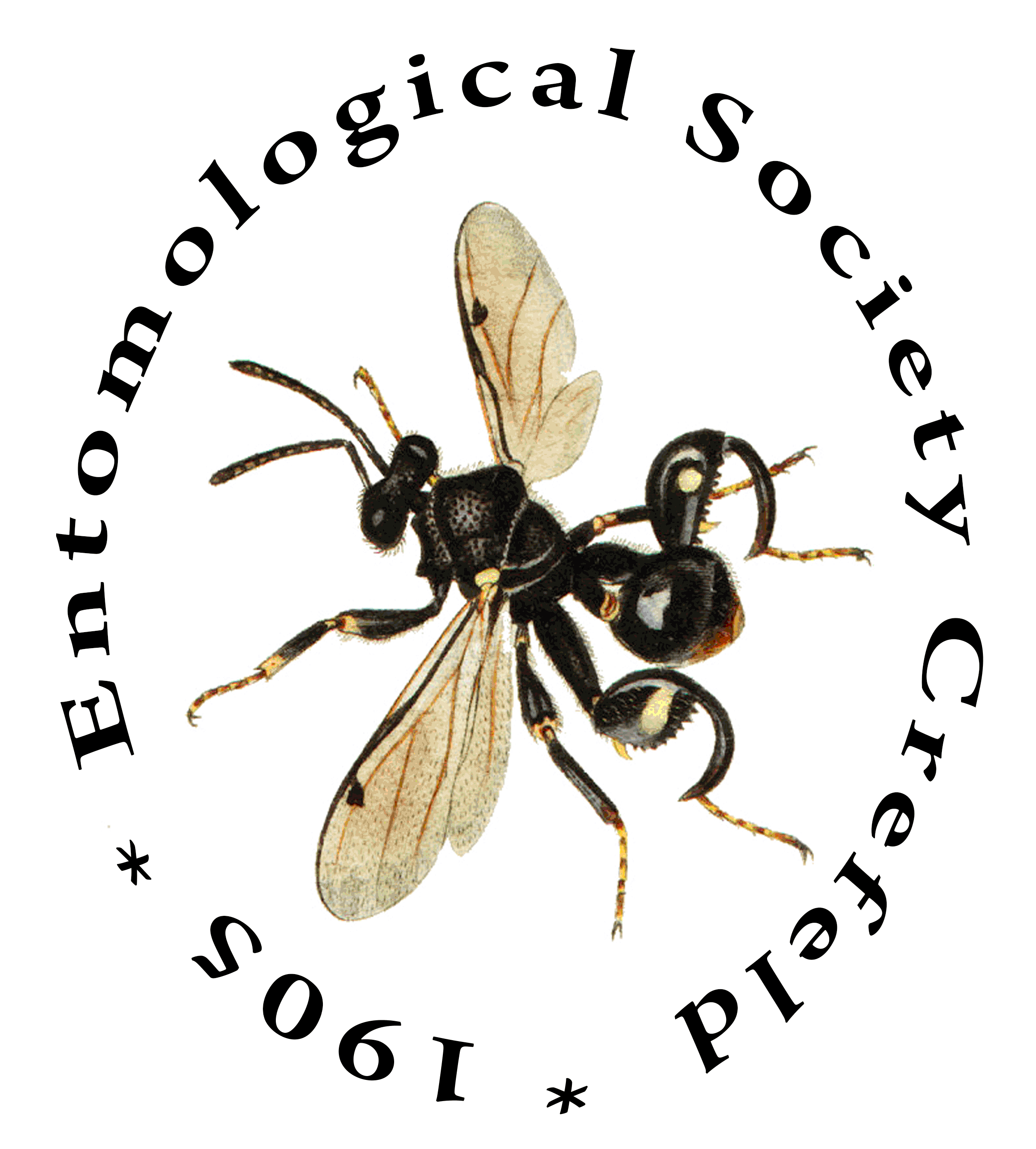


DINA-Konsortium:




bottom of page